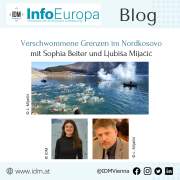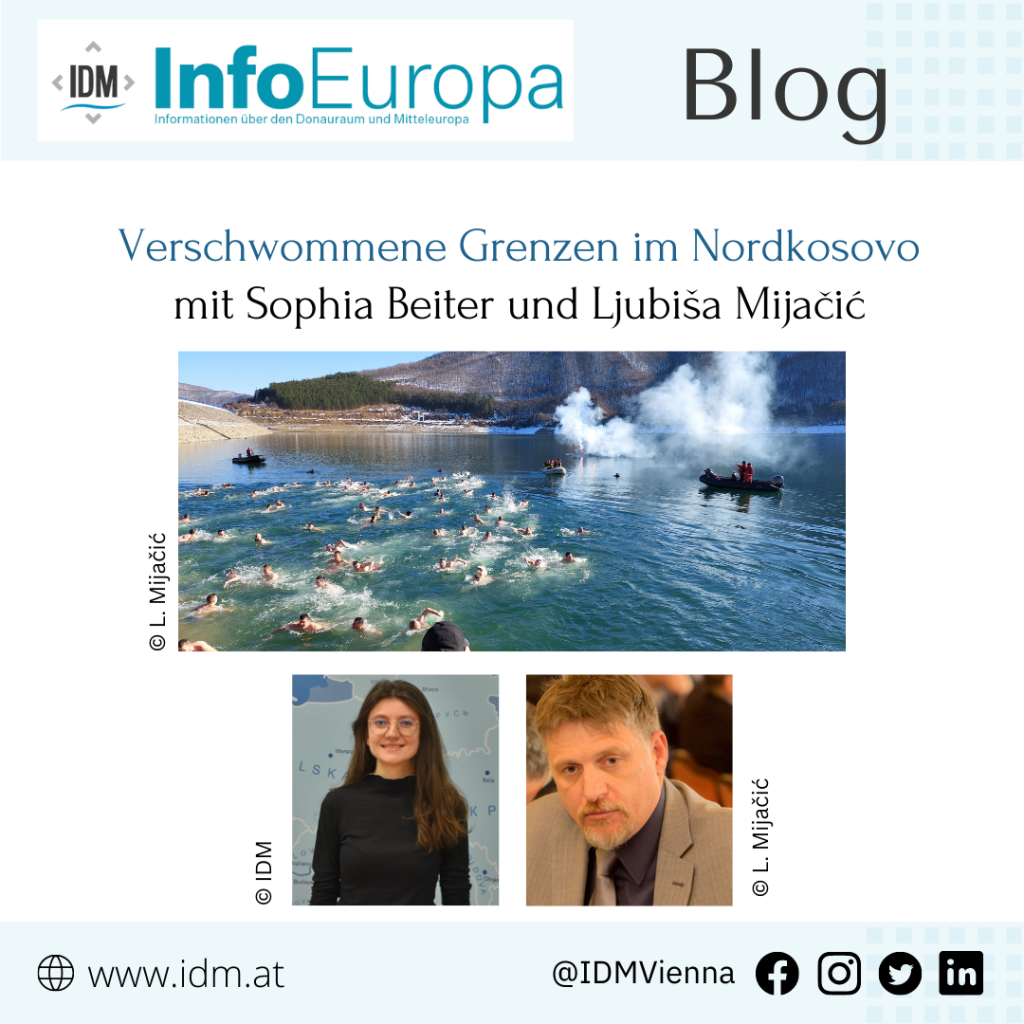Lokaler Bergbau, internationale Gräben

Das polnische Kohlekraftwerk Turów entzieht tschechischen Gemeinden das Grundwasser. Das führte zu einer fast zweijährigen diplomatischen Eiszeit zwischen beiden Ländern. DANIEL MARTINEK und MALWINA TALIK erklären in ihrem Beitrag die unterschiedlichen Länderperspektiven auf das Thema.
Der Text wurde in der Ausgabe 2/2023 von Info Europa veröffentlicht. Die vollständige Ausgabe ist hier zu lesen.
»Bagger kommen jeden Tag näher an unsere Häuser und die negativen Auswirkungen des Tagebaus werden immer schlimmer.« Das schreibt der Nachbarschaftsverein Uhelná in einem offenen Brief an die tschechische Regierung im Mai 2021. Die gleichnamige nordböhmische Gemeinde ist eine von vielen, die von den Umweltbelastungen des polnischen Kohlekraftwerks Turów betroffen ist. Im selben Monat ordnete der Europäische Gerichtshof (EuGH) die Einstellung des Tagebaus an, der Kohle zum Kraftwerk fördert. Im Urteil heißt es, dass »drohende Schäden für die Gesundheit der tschechischen Bevölkerung und die Umwelt unumkehrbar sind, während es sich auf polnischer Seite um kompensierbare finanzielle Schäden handelt«. Sollte die Kohleförderung nicht umgehend eingestellt werden, falle eine Strafe an die EU-Kommission von einer halben Million Euro pro weiterem Betriebstag an.
Die Entscheidung des EuGH war ein Schock für Polen und spaltete die Gesellschaft. Die einen warfen der polnischen Regierung Ignoranz vor, die anderen meinten, die tschechische Regierung übertreibe mit der Klage und nutze das Thema für die anstehenden Parlamentswahlen aus. Polen setzte die Arbeiten im Tagebau ungeachtet des EuGH-Urteils fort. Zwar kamen Polen und Tschechien kurz darauf zu einer Einigung, vorerst merken die Einwohner*innen von Uhelná aber nichts davon. Polen zahlte Tschechien 45 Millionen Euro Entschädigung für den Rückzug der Klage. Perspektivisch werden Schritte eingeleitet, um die Grundwasserabsenkung auf tschechischer Seite sowie die Lärmbelästigung zu verringern. Bis diese Maßnahmen wirken, werden aber wohl noch Jahre vergehen und die Probleme für Anrainer*innen bleiben bestehen.
Die EU-Nachbarländer waren stets enge Partner in der Visegrád-Gruppe. Doch Turów ließ die Beziehungen deutlich abkühlen. Da für den Kohlegewinn der Boden entwässert wird, und das bis in mehrere hundert Meter Tiefe, sank der Grundwasserspiegel rund um den polnischen Tagebau bis zu 60m ab – auch auf tschechischer Seite.
Vom Freund zum Feind
»Sollen wir heute den Geschirrspüler oder die Waschmaschine einschalten?« Das ist eine Frage, die sich die tschechische Familie Kronus oft stellt. Ihr Brunnen reicht für den Wasserverbrauch der ganzen Familie nicht mehr aus. Michael Martin aus dem Nachbardorf Václavice muss zu seinem Nachbarn, um Trinkwasser für seine Familie zu besorgen. Es sind nur einzelne Geschichten, die die lokale grenzübergreifende Organisation Stop Turów sammelte. Doch in Zukunft kommen wohl noch weitere Geschichten dazu: Denn der Tagebau soll nach Plan des Eigentümers Polska Grupa Energetyczna (PGE) weiter ausgebaut und künftig auf weniger als 100m zur tschechischen Grenze erweitert werden. Stop Turów zufolge könnte dadurch 30.000 tschechischen Einwohner*innen das Trinkwasser entzogen werden, aber auch das gesamte lokale Ökosystem steht vor beträchtlichen existenziellen Herausforderungen.
Die polnische Seite der Grenze gleicht einer Wüstenlandschaft: Das Gebiet des Tagebaus Turów verschlingt jedes bisschen Grün. Neben ihm liegt das fünftgrößte Kraftwerk Polens, wesentlich für die Energieversorgung der Region. Doch warum stören sich die Pol*innen nicht an den Umweltbelastungen des Tagebaus? Vorerst hat dies wirtschaftliche Gründe. PGE ist der größte Stromproduzent im Land und gleichzeitig der größte Arbeitgeber in der Umgebung, rund 5000 Menschen sind bei PGE und der dazugehörigen Industrie beschäftigt. Laut polnischen Behörden käme eine sofortige Einstellung des Kraftwerks einer Katastrophe gleich: steigende Arbeitslosigkeit, eingeschränkter Zugang zu Strom, Heizung und paradoxerweise auch zu Wasser. Das Kraftwerk reinigt nämlich die Abwässer aus der Stromproduktion und liefert das Wasser an benachbarte polnische Städte wie Bogatynia. 72% des dortigen Wasserbedarfs werden vom Kraftwerk gedeckt. Aus diesen Gründen sind die Gegenstimmen auf polnischer Seite leiser als auf der tschechischen, wo die lokale Bevölkerung kaum wirtschaftlich profitiert und gleichzeitig unter der fremdverursachten Wasserarmut leidet.
Dicke Luft im Dreiländereck
Der im Dreiländereck Deutschland-Polen-Tschechien gelegene Tagebau existiert bereits seit 1904. Dass er ausgerechnet jetzt zum internationalen Streitfall wird, liegt daran, dass Polen die ursprünglich in 2020 auslaufende Konzession ungeachtet der Einwände Deutschlands und Tschechiens bis 2044 verlängerte – und das zu einer Zeit, in der zunehmende Trockenheit die Wasserknappheit in der Region ohnehin schon verschlimmert und der Trend hin zu erneuerbaren Alternativen geht. Prag konnte die Bedenken der Tschech*innen nicht länger ignorieren und wandte sich 2021 an den EuGH. 2022 klagte auch die deutsche Gemeinde Zittau, allerdings vor einem polnischen Gericht. Die Rechtswege verschlechterten die Beziehungen zwischen den zwei Visegrád-Ländern immens. Dass die polnische Botschaft in Prag seit 2020 unbesetzt war, trug nicht zur Verbesserung der Situation bei. Nachdem der Botschafter im November 2021 endlich antrat, wurde er im Jänner 2022 von der polnischen Regierung wieder abberufen, weil er sich kritisch über die Vorgehensweise im Fall Turów äußerte. »Es mangelte an Empathie, Verständnis und Dialogbereitschaft – vor allem auf polnischer Seite«, sagte er in einem Interview mit Deutsche Welle. Verwerfungen gab es allerdings nicht nur auf Regierungsebene, auch die lokale Bevölkerung reproduzierte den Konflikt. Es kam sogar zu einem Zwischenfall, in dem ein Restaurant in Bogatynia Tschech*innen die Bedienung verwehrte – so hieß es zumindest auf einem Schild an dessen Eingangstür. Der EuGH wählte auch einen ungünstigen Zeitpunkt für sein Urteil. Zweimal binnen dieser Woche kam das größte Kraftwerk Polens, Bełchatów, wegen Pannen für mehrere Stunden zum fast kompletten Erliegen. In diesem Zusammenhang schien es für Polen außer Frage Turów sofort abzuschalten.
Kein Platz für Energie-Nationalismus
Mit der neuen tschechischen Regierung von Petr Fiala zog Prag die Klage gegen Warschau 2022 beim EuGH zurück und beide Länder schlossen ein Abkommen. Neben der Entschädigungssumme sollte dieses auch die Auswirkungen des Tagebaus auf die Umwelt eindämmen. Ein Erdwall soll gegen die Lärmbelästigung errichtet werden und eine unterirdische Dichtwand soll eine weitere Absenkung des Grundwasserspiegels verhindern. Die Dichtwand ist bereits seit Juni 2022 in Betrieb und bisherige Ergebnisse zeigen, dass sich der Rückgang des Grundwassers auf dem tschechischen Gebiet verlangsamt.
Der Abschluss des Abkommens und die Beruhigung der zwischenstaatlichen Beziehungen sind sicherlich auch auf die politisch-ideologische Nähe der polnischen Partei PiS und der tschechischen ODS zurückzuführen, die mehr als eine kritische Meinung zu den Transformationsbestrebungen der EU teilen, wie zum Beispiel zum Benzin- und Dieselfahrverbot oder zu den Emissionszertifikaten für Wohnen und Verkehr.
Dennoch sind die im Abkommen geplanten Maßnahmen sowohl im Hinblick auf das strategische Gesamtkonzept der sozial-ökologischen Transformation der Region als auch auf die EU-weite grüne Kohäsionspolitik völlig unzureichend. Laut Stop Turów bestätigen Energie-Expert*innen, auch aus Polen, dass das polnische Stromnetz nach 2030 auf Turów verzichten könne. Die Nutzung erneuerbarer Energiequellen wie Wind und Sonne könnte in Zukunft den Strom des Kohlekraftwerks Turów ersetzen. Ihrer Meinung nach ist das Festhalten der polnischen Regierung an Kohlekraftwerken eine klare Manifestation des sogenannten Energie-Nationalismus. So wird von vielen Vertreter*innen der PiS-Partei die Dekarbonisierung als ein von Deutschland inszenierter EU-Plan zur Zerstörung des polnischen Kohlesektors dargestellt.
Die hohe Schädlichkeit von Tagebauen für Grundwasserspiegel ist kein Geheimnis. Obwohl Turów zweifellos das berüchtigtste Kraftwerk im Dreiländereck ist, ist es keinesfalls das einzige in diesen Ländern. Bewohner*innen mehrerer tschechischen Regionen, wie zum Beispiel um die Kraftwerke Počerady oder Ledvice in Nordböhmen, sowie Karviná und Ostrava-Třebovice in der mährisch-schlesischen Region, leiden ebenso unter den negativen Folgen des Kohlebergbaus. In Deutschland schaffen es Protestaktionen von Umweltschützer*innen immer wieder in die internationalen Schlagzeilen. Und sowohl Polen als auch Tschechien stehen vor einer Wasserkrise – beide Länder haben die geringsten erneuerbaren Wasserressourcen pro Kopf im EU-Vergleich.
Grüne Evolution statt Revolution
Wie Polen steht daher auch Tschechien auf dem Transformationspfad zu einer technologisch modernen, klimasicheren und nachhaltigen Energieerzeugung vor vielen Herausforderungen. So müssen beide Länder noch Teile der Bevölkerung von der Notwendigkeit dieser Transformation überzeugen. Nationalkonservative Tendenzen sind dafür der falsche Weg. Fälle wie Turów stoßen allerdings Umdenkprozesse an. Tschechien plant bis 2038 alle Kohlekraftwerke vom Netz zu nehmen und sie durch Wind-, Solar- oder Kernkraftwerke zu ersetzen. Letztere wurden von der EU-Kommission zuletzt als grün eingestuft, nicht alle Expert*innen teilen diese Ansicht. Der schleppende Prozess bedeutet für Anrainer*innen von Kohlekraftwerken dennoch mindestens 15 weitere unsichere Jahre.
Polen zählt zu den zehn größten Kohleproduzenten der Welt. Ein Ausstieg aus der Industrie wird wirtschaftlich nicht einfach, die Anzahl der Beschäftigten in diesem Bereich sinkt aber allmählich. Die Mehrheit der Pol*innen betrachtet den Klimawandel als Gefahr und befürwortet die grüne Transformation. Mit steigendem Wohlstand kommt ein Bedürfnis nach einer sauberen Umwelt. Seit Jahren leidet das Land unter Luftverschmutzung, im Winter ist der Smog oft so schädlich, dass die Einwohner*innen betroffener Regionen eine Warn-SMS bekommen, das Haus nicht zu verlassen, wenn es nicht notwendig ist. Umweltkatastrophen wie das Fischsterben und die Vergiftung des Flusses Betschwa in Mähren 2020 und der Oder in Polen 2022 veranschaulichen den Tschech*innen und Pol*innen, was passiert, wenn Klimawandel auf Verschmutzung trifft. Die Stimmen nach nachhaltiger Veränderung werden also lauter.
Malwina Talik ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin am IDM sowie freiberufliche Forscherin und Übersetzerin. Davor war sie als Expertin für wissenschaftliche Zusammenarbeit bei der Polnischen Akademie der Wissenschaften/Wien und Referentin für Öffentlichkeitsarbeit bei der Polnischen Botschaft in Wien tätig.
Daniel Martínek M.A. ist Doktorand an der Westböhmischen Universität in Pilsen, Tschechien, und arbeitet als Wissenschaftlicher Mitarbeiter am IDM.