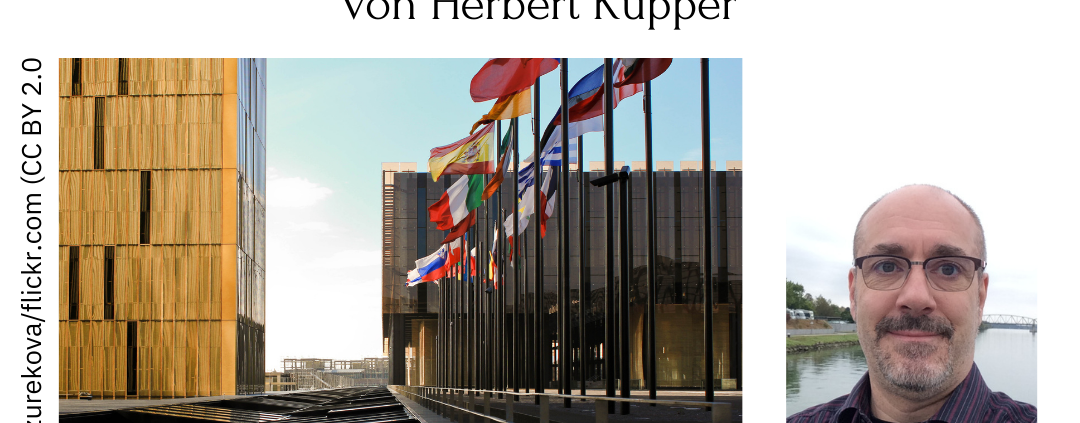Rechtsstaatlichkeit im Vergleich: »Westliche Arroganz ist fehl am Platz«

Der Rechtswissenschaftler Herbert Küpper kennt die Ecken und Kanten europäischer Rechtsstaatlichkeit. Für Info Europa zeigt er vorhandene Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen den EU-Mitgliedsstaaten auf und fordert beim Blick »nach Osten« mehr Dialog auf Augenhöhe.
Alle Staaten Europas, mit Ausnahme des Vatikans, definieren sich als Rechtsstaaten. EU-Mitgliedern ist die Rechtsstaatlichkeit ein verbindlicher gemeinsamer Wert (Art. 2 EU-Vertrag). Nichtsdestotrotz gibt es in Europa drei Traditionen: die britische rule of law, die französische légalité und den Rechtsstaat des deutschen Sprachraums. Ihnen gemeinsam ist die Überwindung von Willkür durch für alle geltende Regeln. Seit 1945 durchdringen sich diese Traditionen zunehmend. Insbesondere der deutschsprachige »Rechtsstaat« hat auch nach Osten ausgestrahlt. Der Sozialismus beendete alle rechtsstaatlichen Ansätze, denn er lehnte den Rechtsstaat ab. Zwar lebten in den Ländern, die vor dem Sozialismus Rechtsstaaten gewesen waren, unterschwellig rechtsstaatliche Elemente fort. Als Wert war der Rechtsstaat jedoch bis in die 1980er Jahre desavouiert. Westeuropa blieb diese Erschütterung erspart. Hier konnte sich der Rechtsstaat organisch fortentwickeln – abgesehen von dem Kollaps des Rechtsstaats zwischen 1933 und 1945 in Deutschland. Aus der Konvergenz der unterschiedlichen Traditionen, die u. a. durch die Aufarbeitung des NS-Unrechts neue Dimensionen erhielten, bildete sich eine gemeinsame westeuropäische Rechtsstaatsidee, die auch der EU zugrunde gelegt wurde.
Rechtsstaatlichkeit als gemeinsamer Wert
Nach der Wende verkörperte der Rechtsstaat besser als andere Werte die neue Ordnung. Hierbei orientierten sich die »neuen« Rechtsstaaten Osteuropas naturgemäß am Westen. Ihre eigenen Traditionen waren 1990 nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Außerdem wollten die Staaten, die soeben den Eisernen Vorhang überwunden hatten, Teil eines gesamteuropäischen »Raums der Rechtsstaatlichkeit« werden. Hierbei haben die Staaten und Gesellschaften in Osteuropa enorme Anpassungsleistungen erbracht: Von einem Tag auf den anderen wurden Staat, Recht, Gesellschaft und Wirtschaft auf diametral entgegengesetzte Werte umgestellt. Eine der größten Leistungen war der Aufbau eines Rechtsstaats. Rechtsstaat ist kein statischer Zustand, sondern ein Prozess. Ihn in der Verfassung festzuschreiben reicht nicht. Er lebt jeden Tag aufs Neue in Millionen staatlicher Akte, in denen die StaatsdienerInnen der Versuchung widerstehen, willkürlich aufzutreten und/oder sich zu bereichern. Hierzu bedarf es ausgefeilter Gesetze, eines hohen Ethos in einem vernünftig bezahlten öffentlichen Dienst und einer Zivilgesellschaft, die Rechtsstaatlichkeit einfordert. Diesen Herausforderungen haben sich die Staaten Osteuropas, vor allem die neuen EU-Mitglieder, gestellt. Auch wenn die Erfolge unterschiedlich ausfielen und ausfallen, wurde überall Enormes geleistet. Dem widerspricht der aktuelle Abbau des Rechtsstaats in einigen östlichen EU-Staaten wie Ungarn oder Polen nur scheinbar. Dahinter steht unter anderem das Gefühl, die eigenen Leistungen würden von einem besserwisserischen Westen bis heute nicht hinreichend gewürdigt. Deshalb wendet man sich von der ohnehin unerreichbar scheinenden westlichen Rechtsstaatsidee ab und kreiert einen eigenen »nationalen« Rechtsstaat. Der Rechtsstaat wird aus Sicht autoritärer Osteuropäer nicht negiert, sondern modifiziert, zu seinen »echten europäischen« Wurzeln zurückgeführt.
»Moderner« Osten, »veralteter« Westen?
Aufgrund der erwähnten Runderneuerung der Rechtsordnungen seit 1990 besitzen viele osteuropäische Staaten heute Gesetze, die als Ergebnis intensiver Rechtsvergleichung und westlicher Beratungshilfe »modern« sind. Viele westeuropäische Gesetze hingegen sind Jahrzehnte, gar Jahrhunderte alt und weisen trotz ständiger Anpassungen ein Modernitätsdefizit auf. Das gilt auch für Gesetze im Kernbereich der Alltagsrechtsstaatlichkeit, im allgemeinen Verwaltungsrecht. Das österreichische Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz wird in fünf Jahren 100. Auch wenn es noch immer die »Mutter aller Verwaltungsverfahrensgesetze« ist, ist sein Reformbedarf unabweisbar. Die deutsche Verwaltungsgerichtsordnung von 1960 regelt den Zugang der BürgerInnen zum Gericht so umständlich und lückenhaft, dass sie, würde sie heute erlassen, vom Bundesverfassungsgericht wohl aufgehoben werden würde und auch vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) und dem Europäischen Menschenrechtsgerichtshof (EGMR) keine Gnade fände; sie genügt rechtsstaatlichen Ansprüchen nur dank einer richterlichen Praxis, die sich über die Mängel des Gesetzes hinwegsetzt. Zur Behebung des Reformbedarfs alter westlicher Gesetze bietet sich ein Blick nach Osten an: Die dortigen Vorschriften sind dank der sorgfältigen komparativen Vorarbeiten oft Gesetz gewordene moderne »best practices«. Warum also das Rad neu erfinden, warum nicht bei der allfälligen Modernisierung westlicher Gesetze in die Gesetzestexte im Osten schauen? Liefe das Lernen nicht nur von West nach Ost, sondern auch von Ost nach West, würde das auch dem populistisch ausbeutbaren Gefühl in Osteuropa, nie aus der Rolle des »armen Verwandten« herauszukommen, die Grundlage entziehen.
Voneinander lernen
Die Rezeption von Ost nach West hat allerdings Grenzen. Das alltägliche Rechtsstaatsniveau der Verwaltungen im Westen ist höher als das im Osten. Wo sich dies in den östlichen Gesetzestexten widerspiegelt, zum Beispiel in der Betonung von Top-down-Verfahren und dem Verzicht auf konsensuale Entscheidungsmöglichkeiten wie dem Vertrag zwischen Verwaltung und BürgerInnen, sind sie nicht »modern« genug, um als Inspiration und Gegenstand einer Rezeption zu dienen. Dies sollte und kann in einem West-Ost-Dialog auf Augenhöhe, zwischen gleichberechtigten Partnern, die grundsätzlich etwas voneinander lernen können, geklärt werden. Westliche Arroganz, verbunden mit einem erhobenen Zeigefinger, ist fehl am Platz.
Prof. Dr. Dr. h.c. Herbert Küpper studierte Rechtswissenschaften in Köln und London und absolvierte seine Referendarausbildung in Köln und Budapest. Ab 2003 Wissenschaftlicher Referent, seit 2004 Geschäftsführer des Instituts für Ostrecht München. Forschungsschwerpunkte: ungarisches Recht, postsozialistisches Recht, vergleichendes öffentliches Recht. Lehraufträge in Budapest, Pécs, Szeged, Wien. Vizepräsident der Südosteuropa-Gesellschaft.