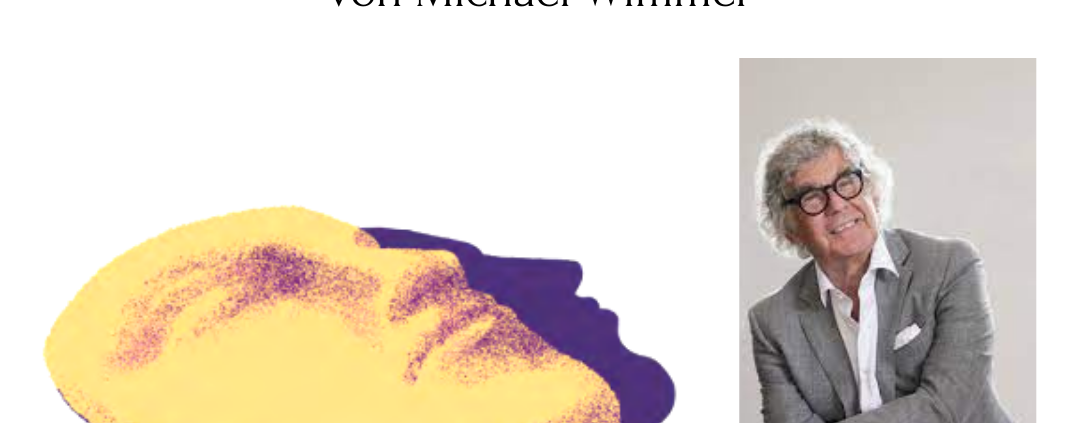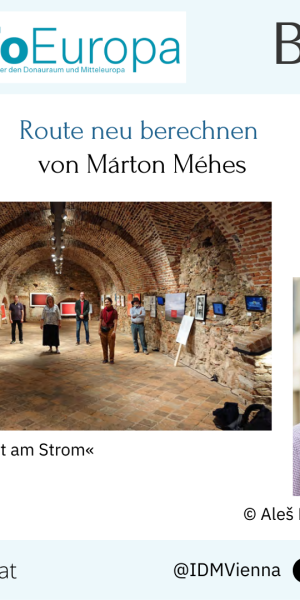Schön, wahr, streitbar?

Was heißt es für eine Gesellschaft, wenn alles an ihr nur mehr relativ erscheint? Wenn Trennlinien verschwimmen und Etabliertes in Frage steht? Der Politologe MICHAEL WIMMER kennt die österreichische Kulturlandschaft und schreibt über die Chancen und Gefahren in Zeiten des Umbruchs.
Als Heranwachsender in den 1950er und 1960er Jahren schien die Welt noch in Ordnung. Die zentralen Instanzen Familie, die Großparteien und der Staat samt seiner Vermittlungsagentur Schule, darüber hinaus die katholische Kirche und der Kulturbetrieb, gaben klare Weltbilder vor und verpflichteten zu verbindlichen Verhaltensregeln. Ich konnte damit nicht einverstanden sein und versuchte, dagegen aufzubegehren. Und doch lag über der gesamten Gesellschaft eine rigide Eindeutigkeit von richtig und falsch, gut und böse sowie schön und hässlich, der sich kaum jemand zu entziehen vermochte. Der Staat verfügte über die »richtige« Kultur, die durch Kultureinrichtungen repräsentiert wurde. AbweichlerInnen wurden mit Gesetzen sanktioniert, die dafür sorgen sollten, eine für alle verbindliche österreichische Kultur in der Bevölkerung durchzusetzen. Zu ihrer Verbreitung gab sich der Staat einen Erziehungsauftrag, der die »Kulturlosen« mit der staatlich verordneten Kultur vertraut machen sollte. Nicht zuletzt, um damit die Bemühungen zur nationalen Identitätsbildung zu unterstützen. Diese »Leitkultur« wurde erstmals in der zweiten Hälfte der 1970er Jahre hinterfragt. Damals traten vor allem junge Menschen zunehmend öffentlichkeitswirksam auf den Plan, um sich dem staatlich verordneten Sog des einzig Richtigen, Wahren und Schönen entgegenzusetzen. Aus dem Geist der ausgegrenzten Subkulturen der 1960er Jahre erwuchsen nach und nach Alternativbewegungen, die Anspruch auf eine eigene Interpretation der Welt gegen jene des Establishments erhoben. So bildeten neue Kulturinitiativen den Nukleus der Infragestellung einer rückwärtsgewandten Kulturpolitik, die sich weigerte, von ihrem paternalistischen Selbstverständnis abzurücken und alles tat, um kultureller Selbstermächtigung entgegenzuwirken.
Monopole am Ende
Damit einher ging seit den 1980ern ein Diskurs, der die Künste als gemeinschaftsstiftender Faktor in Frage stellte. Beschrieb der italienische Philosoph und Schriftsteller Umberto Eco noch eine Tendenz in Richtung »offenes Kunstwerk«, so sprach der US-Amerikaner Arthur C. Danto gleich vom »Ende der Kunst«. Beide folgten der Entwicklung der Avantgarde des 20. Jahrhunderts, die in ihrem Kampf gegen die Hermetik des Kulturbetriebs die Auflösung des etablierten Kunstbegriffs immer weitertrieb. Am Ende landeten sie bei der Aussage, dass im Prinzip alles Kunst sein kann. Damit wurde eine gesicherte Trennlinie zwischen Kunst und NichtKunst eliminiert, was bei Nichteingeweihten für Ratlosigkeit sorgte. Ähnliches trifft auf den Wissenschaftsbetrieb zu. Eine der Ursachen für seine tendenzielle Entwertung liegt darin, dass – wie in den Künsten – schon lange vor der Pandemie ein Relativierungsprozess einsetzte. Wissenschaft verlor das aufklärerische Interpretationsmonopol der Welt. Verblüfft stellen wir aktuell fest, dass selbst Hochgebildete rationale Erkenntnis auf die gleiche Stufe der Weltwahrnehmung stellen wie irrationalen Glauben. Das macht deutlich, dass das Pendel der Rationalität immer mehr zur Emotionalität ausschlägt. Auch die Medien unterliegen einem Transformationsprozess. Sie verloren ihre Stellung als VermittlerInnen einer konsistenten, auf soliden Recherchen basierenden Weltsicht. Als sensationsgeile AkteurInnen am hart umkämpften Medienmarkt büßten sie viel an Glaubwürdigkeit ein. Die Repräsentation von Öffentlichkeit traten sie an die – jedenfalls vordergründig – stärker auf Mitwirkung und Interaktion angelegten Sozialen Medien ab. In ihnen geben nicht mehr Fachleute die Inhalte vor. Alle können mitreden, Informationen weitergeben, Meinungen kundtun und zu Aktivismus aufrufen. Soziale Medien sind vielleicht die überzeugendste Ausdrucksform dafür, dass der Staat und seine Agenturen das Monopol der Weltinterpretation verloren haben. An ihre Stelle treten die BürgerInnen selbst, die Wahrheit, Schönheit und Richtigkeit kreieren bzw. sich in temporären Allianzen denen anschließen, die mit ihnen auf einer Wellenlänge zu sein scheinen.
Kultur auf neuen Bahnen
In all diesen Auflösungserscheinungen samt ihren zum Teil gefährlichen, zum Teil hilflosen Gegenreaktionen, platzt aktuell die nunmehr bereits zwei Jahre währende Pandemie als die wahrscheinlich größte gesellschaftliche Herausforderung nach dem Zweiten Weltkrieg. Spätestens die Auswirkungen der Pandemie haben gezeigt, dass nicht nur in Österreich eine tiefsitzende Verunsicherung entsteht. Diese speist sich einerseits aus der wachsenden und irgendwann nicht mehr aushaltbaren Komplexität der Lebenswelten und andererseits aus dem gebrochenen Versprechen des sozialen Aufstiegs durch Leistung und dem damit verbundenen Zusammenbruch des solidarischen Zusammenhalts. Der deutsche Soziologe Armin Nassehi spricht von einer »überforderten Gesellschaft«. Ein massenhaftes Aufbegehren gegen die herrschenden Verhältnisse, aus den verschiedensten Ecken, scheint nur zu logisch. Die frustrierten SkeptikerInnen, bei denen sich ein langjähriger Hass gegen Politik, Wissenschaft, Medizin, Medien, gegen Bildungseinrichtungen und auch gegen die Arroganz des Kulturbetriebs aufgestaut hat, finden endlich ein Ventil und schließen sich zu einer, wenn auch unheiligen, Allianz zusammen. Auch wenn die Bekämpfung der Pandemie im Moment alles andere überstrahlt, so lässt sich das wachsende Heer derer, die mittlerweile fast täglich gegen die Maßnahmen der Regierung demonstrieren, in zwei Richtungen lesen. Einerseits als Rückfall in kollektiven Irrationalismus und andererseits als gesellschaftlicher Emanzipationsprozess, der sich auf die Suche nach machbaren Zukunftsszenarien macht. Geht es nach den Erwartungen vieler junger Menschen, dann stehen wir heute vor der Aufgabe, Politik neu zu denken. Das Erproben von Mitbestimmungsmodellen wie BürgerInnenbeteiligung, neue Governance-Strukturen oder BürgerInnenräten steht für diesen durchaus optimistisch machenden Trend. Voraussetzung dafür ist die Wiederherstellung von Öffentlichkeit bzw. von öffentlichen Räumen, in denen Menschen ganz unterschiedlicher Hintergründe aufeinandertreffen, sich austauschen, verhandeln und Kompromisse schließen. Dem Kulturbetrieb könnte dabei eine wichtige Aufgabe zukommen. In Zeiten der Pandemie sehen wir vor allem die Zentrifugalkräfte am Werk. Die mindestens ebenso wirksamen Zentripetalkräfte werden unterschätzt. Und doch sind sie es, die bei der Deutungshoheit für ein besseres Morgen entscheidend sein werden. Eine solche, so lernen wir aus der Geschichte des Emanzipationsprozesses der letzten 50 Jahre, will nicht mehr als sakrosankt vorgegeben werden. In einer streitbaren Zivilgesellschaft muss diese von uns allen täglich neu erkämpft werden.
Dr. Michael Wimmer ist Gründer und Direktor von EDUCULT, Vorstand des Österreichischen Kulturservice (ÖKS), Musikerzieher und Politikwissenschaftler. Er doziert an der Universität für angewandte Kunst Wien und arbeitet als Lehrbeauftragter am Institut für Kulturmanagement und Gender Studies der Universität für darstellende Kunst Wien sowie am Institut für Lehrer*innenBildung der Universität Wien. Seine Expertise umfasst die Zusammenarbeit von Kunst, Kultur und Bildung. Er war in der Expertenkommission zur Einführung der Neuen Mittelschule und berät den Europarat, die UNESCO und die Europäische Kommission in kultur- und bildungspolitischen Fragen.