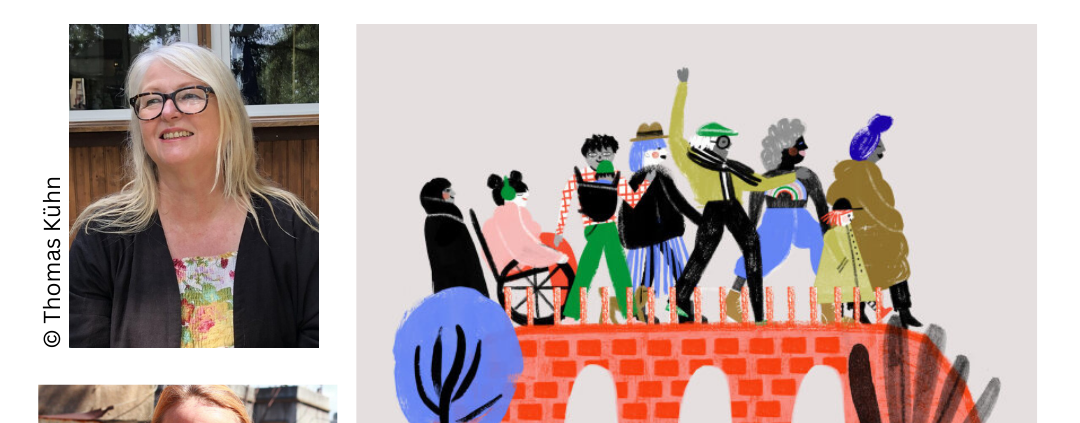Im Grenzverkehr der Mobilitäten

Nicht alle Reisenden treffen auf die gleichen Grenzen. In ihrem Gastbeitrag erklären REGINA RÖMHILD und JOHANNA ROLSHOVEN, wie Unterschiede in der globalen Freizügigkeit entstehen und herausgefordert werden können.
Wer heute aus einem der Länder des globalen Südens in den Norden unterwegs ist, trifft auf andere Grenzen als jemand, der in umgekehrter Richtung reist. Das Motiv mag ähnlich sein: die Suche nach einem besseren Leben. Dass hier dennoch große, oft sogar existenzielle bis tödliche Unterschiede gemacht werden, scheint inzwischen „normal“ – nur elitäre, unrealistische Romantiker*innen würden die Notwendigkeit der Grenzen gegenüber dem Süden und Osten anzweifeln. Es scheint ausgemacht, dass weiße Reisende, Tourist*innen und „Expats“ eine privilegierte Freizügigkeit der Wenigen genießen. Ihnen gegenüber steht die Bewegung der Vielen, der nicht-weißen Migrant*innen und Geflüchteten, die an Europas Grenzen aufgehalten werden soll.
Schwarz-Weiß-Malerei der Bewegung
Der Begriff Migration wird fast ausschließlich im Zusammenhang mit der Mobilität und Niederlassung von Menschen aus dem europäischen und globalen Süden und Osten verwendet und mit Problemlagen assoziiert. Migration aus dem europäischen und globalen Norden und Westen wird dagegen ungleich positiver besetzt. An Einwander*innen aus dem europäisch-westlichen Ausland werden kaum dieselben Forderungen der Integration und des Spracherwerbs gerichtet, mit denen Migrant*innen aus der südlichen und östlichen Welt beinahe jeden Tag konfrontiert werden. Und die Tourist*innen, die traditionell Bürger*innen des globalen Nordens sind, bekommen die Grenzen, an denen andere Menschen permanent aufgehalten werden, gar nicht als solche zu spüren.
Das Etikett der Migration bleibt außerdem – auch ohne grenzüberschreitende Mobilität der Beteiligten – mit denselben Konnotationen über Generationen hinweg erhalten. Es wird gewissermaßen politisch vererbt. Nachkommen in der zweiten oder dritten Generation befinden sich noch immer in einem Warteraum der Migration, des Noch-nicht-Dazugehörens. Es zeigt sich also, dass der Begriff „Migration“ keineswegs einer unschuldigen wissenschaftlichen Analysekategorie entspricht, sondern dass er mit langfristigen Politiken der Ein- und Ausgrenzung verflochten ist. Diese Politiken basieren auf kolonialrassistisch aufgeladenen Zuschreibungen, die kulturelle, religiöse und ethnische Unterschiede betonen und so unterschiedliche Zonen der Zugehörigkeit und der Fremdheit schaffen.
Überschattete Identitäten
Der vermeintlich in Mehrheiten und Minderheiten unterscheidbaren Gesellschaft entgeht, dass die so gekennzeichneten und in divergierende Bahnen gelenkten Menschen eigene Strategien der Grenzüberwindung entwickeln. So werden Tourist*innen zu Migrant*innen, sobald sie sich an Urlaubsorten niederlassen. Migrant*innen überqueren mithilfe von Tourismus- oder Studienvisa die Grenzen, die ihnen eine als Migration oder Flucht gekennzeichnete Mobilität sonst verwehren. Migrant*innen arbeiten in der Tourismusindustrie, die sich als größter Arbeitgeber für mobile Arbeitskräfte weltweit erweist. Viele finden sich auch in den Arbeitsverhältnissen des Niedriglohnsektors wieder, der von der Prekarität einer „irregulären“ Grenzüberschreitung profitiert: Osteuropäische Migrant*innen arbeiten in der EU oft als Haushaltshilfen oder Pflegekräfte, Geflüchtete in der entrechteten Landwirtschaft der Mittelmeerländer. Kaum jemand erinnert sich heute noch an eine Zeit vor 1989, als sich der so genannte Ostblock gegen Westeuropa abschottete. Vergessen wurde auch, dass das Mittelmeer damals noch nicht das heutige Massengrab vor den neuen EU-Grenzen war, sondern ein Kommunikations- und Handelsraum mit langer kosmopolitischer Geschichte, in dem Menschen auch von Süden nach Norden und wieder zurück reisten.
Dass dieselbe Mobilität heute zu höchst unterschiedlicher Behandlung an den Grenzen führen kann, zeigen die Erfahrungen von Künstler*innen, die sich, sofern sie mit nordwestlicher Herkunft unterwegs sind, unter der Devise „Kunst ist Grenzüberschreitung“ überallhin frei bewegen können. Mobilität wird von ihnen erwartet, und als privilegierte Reisende werden sie kaum als Migrant*innen gekennzeichnet und aufgehalten. Wenn Künstler*innen jedoch die EU-Grenzen als Flüchtende unter Lebensgefahr passieren, sind sie zwar mit derselben Profession mobil, werden jedoch nicht in derselben sozialen Kategorie verortet. Hier überdeckt die Klassifizierung „Geflüchtete“ sämtliche anderen Identitäten der Betroffenen. Das führt zu einem sozialen und auch professionellen Tod, von dem aus eine (Wieder-)Aufnahme in die Kategorie der Künstler*innen nur schwer zu realisieren ist.
Grenze als Schnittstelle
Das komplexe Zusammenspiel von Grenzen und Mobilitäten versuchen wir als Forschende mit dem Begriff des „Regimes“ verständlich zu machen. Damit meinen wir Regierungsweisen, die heute in europäischen Nationalstaaten und an den europäischen Grenzen ganz besonders im Feld der Flucht und der Migration entwickelt und praktiziert werden. Gerade Nationalstaaten wollen sich mit ihrem faktischen Machtverlust gegenüber weltweiten Flucht- und Migrationsbewegungen nicht abfinden – obwohl diese Einsicht eigentlich notwendig wäre, um über geeignete Alternativen zur ohnehin nicht realisierbaren Abschottung nachzudenken, wie etwa Möglichkeiten einer legalen Einreise. Stattdessen, das zeigte sich besonders deutlich während der Coronapandemie, wurde selbst angesichts eines hypermobilen, an keiner Grenze aufzuhaltenden Virus auf alte, aber eben nicht bewährte Politiken der Grenzschließung gesetzt. Mobilitäten sind heute nicht ohne die Grenzen denkbar, durch die viele aufgehalten, andere wenige aber auch in ihrer kosmopolitisch wirkenden Bewegungsfreiheit noch bestärkt werden. In einer mobileren Welt des Internets lassen sich privilegierte „digitale Nomad*innen“ zur Fernarbeit an den paradiesisch anmutenden Küsten Albaniens nieder und genießen bei westlicher Bezahlung vergleichsweise günstige Lebenshaltungskosten. Umgekehrt finden sich nicht-EU-Bürger*innen in langwierigen Visum-Antragsprozessen, um andernorts ähnliche Arbeitsverhältnisse in Anspruch zu nehmen. Allzu oft wird ihr Antrag abgelehnt.
Aus einer „Perspektive der Migration“, die viel zu selten eingenommen wird, erweisen sich die Grenzzonen nicht nur als einseitig EU-europäisch und nationalstaatlich dominierte Räume, sondern als eine Schnittstelle vielfacher postkolonialer Ordnungen und Migrationspraktiken. Mehr als bisher wäre die Sicht auf globale Verflechtungen, in denen sowohl EU-europäische Politiken als auch migrantische Praktiken eingebettet und wirksam sind, wichtig. Letztlich können wir nur so die weltumspannenden Zusammenhänge eines komplexen Zusammenspiels von Grenzen und Mobilitäten verstehen, das eben nicht nur „von oben“, im Sinne der Interessen der Wenigen, sondern auch „von unten“, aus der Lebenswirklichkeit der Vielen heraus, mitgestaltet wird.
Regina Römhild ist Professorin am Institut für Europäische Ethnologie der Humboldt-Universität zu Berlin. Ihre Forschungsschwerpunkte sind die postkoloniale Anthropologie Europas, urbane Kulturen, postmigrantische Gesellschaft, politische Anthropologie und Grenzräume und Grenzregime, insbesondere im Mittelmeerraum.
Johanna Rolshoven ist Kulturanthropologin an der Universität Graz. Sie forscht zu den Bereichen Politische Anthropologie, Mobilitäten, Stadt-Raum-Kultur, Cultural Studies in Architecture und Critical Humanities.