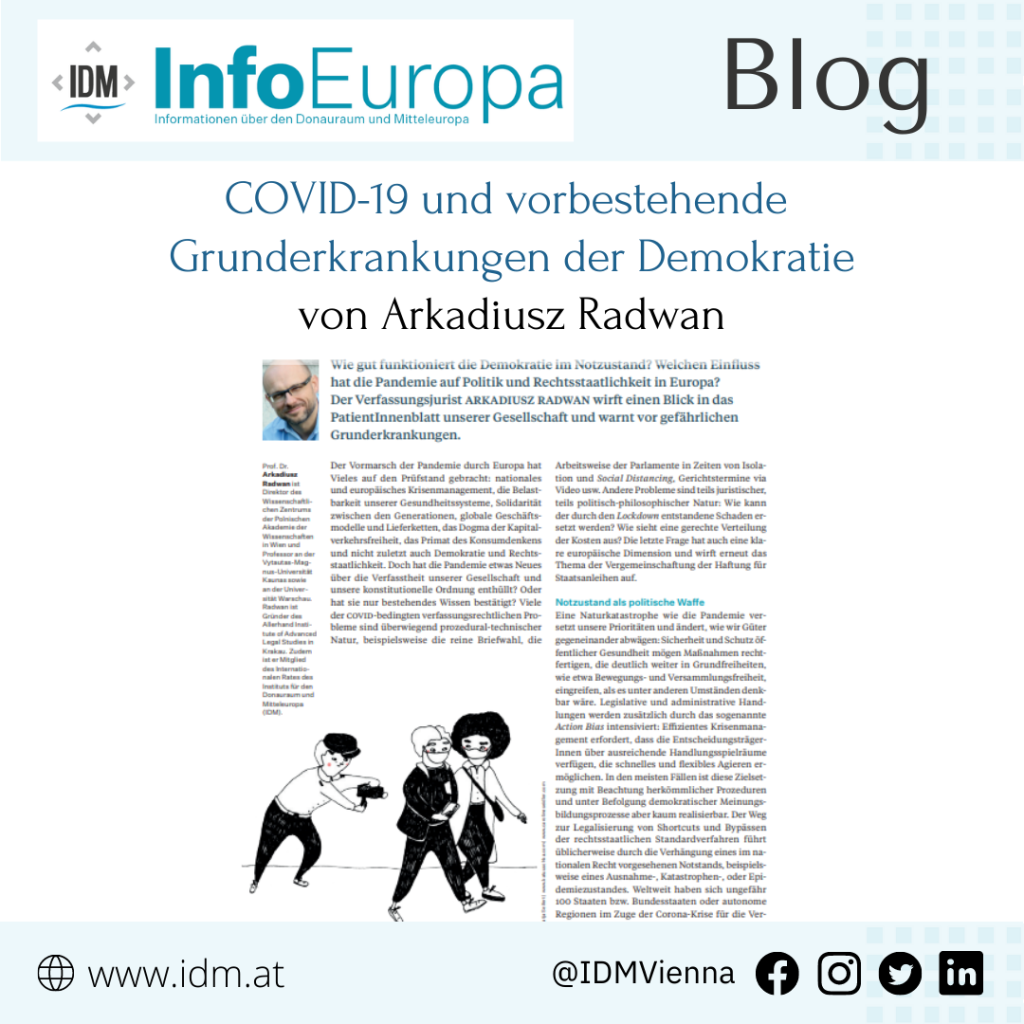Wollen wir die Gesellschaft aktiv als BürgerInnen gestalten oder sind wir lieber »teilzeit-politische« UntertanInnen? Die Juristin Kristin Y. Albrecht fragt in ihrem Essay nach der Verantwortung einzelner innerhalb der repräsentativen Demokratie und warnt vor den Folgen der Passivität.
Er muss ein sehr unangenehmer Zeitgenosse gewesen sein. Einer, der ein Buch über fortschrittliche Kindererziehung schrieb und seine eigenen fünf Kinder auf der Schwelle von Waisenhäusern abgelegt hat. Der seinen Freunden derart auf die Nerven fiel, dass sie ihn, nachdem sie ihn erst aufgenommen hatten, doch wieder vor die Tür setzten. Und doch verdankt man Jean-Jacques Rousseau bis heute grundlegende Beiträge zu Recht und Philosophie, beispielsweise zum Gesellschaftsvertrag.
Im 18. Jahrhundert, als Rousseau den Satz vom sich demokratisch regierenden Volk der Götter schrieb, war die Demokratie die Ausnahme, die Monarchie der Standard. Auch wenn er wichtige Beiträge zur Demokratietheorie leistete, war Rousseau ihr gegenüber kritisch eingestellt. Nur ein Volk von Göttern wäre in der Lage, den Anforderungen der Demokratie gerecht zu werden. Denn diese verlangt ihren BürgerInnen permanent Wachsamkeit und Engagement ab. Das hat der Philosoph den Völkern Europas nicht zugetraut. Dennoch ist die Demokratie heute in großen Teilen europäische Realität. Rousseau hatte Recht: Eine Demokratie muss gelebt werden. Fortlaufend muss man sich informieren und eine Meinung bilden. Die Demokratie ist die dynamischste Staatsform und braucht aktive BürgerInnen, die ihre Verantwortung niemals vergessen. Etwas Erleichterung verschafft ihnen dabei das Verfassungsprinzip der Repräsentation. An die VertreterInnen kann man Verantwortung abgeben. Das ist aber kein Freifahrtschein, sich zwischen den Wahlen zurückzulehnen, »teilzeit-politisch« zu sein. Eine Demokratie lebt durch das Volk.
Bundesverfassungs-Gesetz, Artikel 1: »Das Recht geht vom Volk aus«
Notwendigerweise ist eine Demokratie auch immer ein Rechtsstaat. In demokratischen Rechtsstaaten regieren sich die BürgerInnen durch das Recht, das sie sich selbst gegeben haben. Die Selbständigkeit und die daraus erwachsene Verantwortung liegt immer bei den BürgerInnen. Vereinfacht ausgedrückt: PolitikerInnen sind der verlängerte Arm der BürgerInnen, nicht deren HerrscherInnen. Vielmehr herrscht das Volk in Form des Rechts. PopulistInnen beschwören gerne eine »Repräsentationslücke« und werfen den etablierten PolitikerInnen vor, das »echte Volk« nicht mehr zu vertreten. Doch alle PolitikerInnen unterliegen den Grenzen des Rechts. Eine Demokratie ist nur so gut wie ihr Volk.
Diese Verantwortung bürdet uns BürgerInnen einiges auf: Die Wahl ist hierbei noch die angenehmste Pflicht und erinnert zugleich die Politik regelmäßig an ihre Rolle, in der sie die Herrschaft des Volkes in Form und Grenzen des Rechts vermitteln. Zur Verantwortung der BürgerInnen gehört aber auch die Pflicht, die Demokratie nur von innen zu verändern. Wer mit der medialen Berichterstattung unzufrieden ist, kann ein eigenes Medium gründen oder einen LeserInnenbrief schreiben. Wer mit den PolitikerInnen unzufrieden ist, kann sich in Parteien engagieren und selbst kandidieren oder auf die Straße gehen und für seine Sache demonstrieren. Jede/r Einzelne hat die Macht, etwas zu verändern. In dieser dynamischen Staatsform geht es weniger darum, bestimmte Werte von oben herab zu vermitteln, sondern vielmehr den Weg ihrer Ermittlung – und das ist der eines gezähmten, kultivierten Streits – zu verteidigen. Eine Demokratie ist weniger ein Ziel als ein Weg.
Braucht es einen »Wahlführerschein«? Aktuell wird gerade bei den Demokratien in Osteuropa oft die Frage gestellt, wie es sein kann, dass Demokratien zu freiheitsgefährdenden Ergebnissen kommen. Warum gerade PopulistInnen gestärkt werden. Die Antworten fallen je nach Perspektive unterschiedlich aus. Was allen Ansätzen gemein ist, ist die Diagnose einer innergesellschaftlichen Distanz. Zwischen wem und warum, ist umstritten: Es sei eine soziale Krise der Entfremdung von »Abgehängten« auf dem Land und einer politischen Elite in den Metropolen, lautet die Analyse des polnischen Rechtsphilosophen Wojciech Sadurski zur Krise in Polen. Oder: Es sei eine ökonomische Krise, die die soziale Schere zwischen dem immer reicher werdenden 1 % der Bevölkerung und allen anderen zunehmend aufspreize. Manche gehen sogar soweit, sich die Entwicklungen damit zu erklären, dass »das Volk« schlichtweg intellektuell zu wenig leistungsfähig sei. Andere Ansätze, wie jener der Sozialphilosophin Martha Nussbaum und des Politikwissenschaftlers und Populismusexperten Jan-Werner Müller, sehen dahinter eine Angst bzw. Furcht. Eine eindeutige Antwort auf die Frage gibt es (im Moment noch) nicht. Wie jede Krise ist auch diese nicht monokausal, sondern so komplex, wie es eine globalisierte Welt erlaubt. Zunehmende ökonomische und soziale Spannungen, national wie international, prägen das letzte Jahrzehnt und werden durch technologische Entwicklungen verstärkt.
Um Antworten auf die Krise zu finden, sind zwei Fragen entscheidend. Erstens: Glaubt man daran, dass das Volk in einer repräsentativen Demokratie hinreichend gute Ergebnisse hervorbringt? »Hinreichend gut« meint hierbei das absolute Minimum: Wollen die auf Zeit Regierenden das Beste für das Volk und setzen sie sich aktiv dafür ein? Wollen sie weder die Demokratie noch den Rechtsstaat abschaffen? Traut man dem Volk eine solche Auswahl von PolitikerInnen nicht zu, liegt die Antwort nahe, die Anforderungen an die Wahlberechtigten anzuheben. Nur wer gut informiert ist und sich nicht zurücklehnt, dürfe darüber entscheiden, wer die Macht erhält. »Wahlführerscheine« würden sicherstellen, dass nur ausreichend qualifizierte BürgerInnen die VertreterInnen wählen. Diese Ansätze vergessen jedoch, dass auch in der Demokratie selektiert wird: Es gibt immer Gewinner und Verlierer einer Wahl. Repräsentative Demokratie beinhaltet auch eine Bestenauslese. Damit man die besten BürgerInnen für politische Ämter findet, müssen sich aber auch möglichst viele engagieren und sie müssen durch ihre MitbürgerInnen unterstützt werden. Wenn man dem Volk also zutraut, solche hinreichend guten VertreterInnen zu finden, dann schließt sich eine zweite Frage an: Ist die Beteiligung aller wichtiger als ein (sachlich) bestmögliches Ergebnis? Die Antwort beinhaltet eine Abwägung: Wer der Beteiligung aller den Vorrang einräumt, wird entweder bei einer Stärkung der direkten Demokratie landen oder auf die radikale Idee kommen, AmtsinhaberInnen auszulosen. Letztere, sogenannte LottokratieTheorien, erfordern einen starken Glauben an die Qualifikation jeder Person für jedes Amt. Es gibt also viele Möglichkeiten, mit denen man eine Verfassung nachbessern kann, aber die jetzige Demokratie bietet bereits viele Instrumente. Das wichtigste davon besteht im gesellschaftlichen Dialog über die Ursachen der ökonomischen und sozialen Spannungen. Dialog meint immer zwei Dinge: die eigene Stimme zu erheben und dem/der Nächsten wirklich zuzuhören. Und im nächsten Schritt auch die Bereitschaft, sich nach dem Konsens zu richten.
Gefährdete Freiheit?
Derzeit werden viele verfassungsrechtliche Strukturen in Europa so verändert, dass den BürgerInnen ihre Macht zunehmend weggenommen wird. Die Säulen der Demokratie – Volkssouveränität, Rechtsstaatlichkeit und repräsentative Institutionen – werden teilweise untergraben, die BürgerInnen schleichend entbürgert und zu UntertanInnen reduziert. Man könnte hier von einer Degradierung des citoyens zum burgeois sprechen. Man denke an den Umbau des polnischen Verfassungsgerichtshofs in den vergangenen Jahren, oder an Viktor Orbáns Ausnahmezustand während der Corona-Pandemie, der zeigt, wie leicht die Grundlagen der Demokratie ausgehebelt werden können. Wie angedeutet muss jedoch nicht zwingend die Verfassung geändert werden, wenn man sich in einer Krise wiederfindet. Aber was können (entbürgerte) BürgerInnen machen, wenn ihnen die Voraussetzungen der Demokratie, also ihre Selbstbestimmtheit in Form des Rechtsstaates mit dessen Institutionen, genommen werden? Wenn auch der gesellschaftliche Dialog zur Unmöglichkeit sabotiert wird? Noch ist das nicht der Fall und zudem ist die Demokratie ihren FeindInnen auch nicht wehrlos ausgeliefert. Rousseau schrieb, dass sich der Bürger »in dieser Verfassung … vor allem mit Kraft und Ausdauer wappnen und jeden Tag im Grunde seines Herzens wiederholen (muss): … Ich ziehe eine gefährdete Freiheit einer ruhigen Knechtschaft vor.« Wenn die Freiheit gefährdet ist, müssen die BürgerInnen somit umso mehr zeigen, dass sie keine UntertanInnen sind. Dass sie sich im Rahmen des Rechts erheben, auf die Straße gehen, sich öffentlich äußern, Verantwortung für ihren Staat und ihre Verfassung übernehmen. Dafür braucht es zum Glück keine Göttinnen und Götter.

»Als »syphilis of the law« (Bentham) und »Krücken« (Jhering) verdammt, wird seit über 2000 Jahren immer wieder die Ausrottung von Rechtsfiktionen gefordert. Genauso leidenschaftlich werden sie aber auch als höchst wertvoll verteidigt und sogar zur Grundlage des Rechts (Kelsen) erklärt. Wie passt das zusammen? Kristin Albrecht zeigt auf Grundlage einer historischen und rechtsvergleichenden Analyse, dass man im Recht nicht »der Rechtsfiktion« begegnet, sondern drei unterschiedlichen Typen: Den fiktiven Annahmen, den fiktiven Personen und den fiktiven Rechtsinstituten. Sie entwickelt diese Typen mit philosophischer Gründlichkeit und diskutiert anschließend, was »so troubling« bzw. »beneficial and useful« (Blackstone) an ihnen ist.«
Dr. Kristin Y. Albrecht forscht und lehrt als Senior Scientist an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Paris-Lodron Universität Salzburg. Davor hat sie dort als Universitätsassistentin eine Dissertation zum Thema »Fiktionen im Recht« verfasst, welche 2020 im NomosVerlag erschien. Vor dieser Zeit war sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich des öffentlichen Rechts an der Ruprecht-Karls Universität Heidelberg tätig, wo sie auch ihr Studium absolvierte.