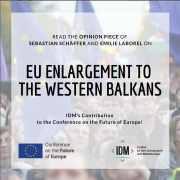Wie gut ein Staat funktioniert, zeigt sich oft anhand unserer Erfahrungen im Umgang mit Behörden und Ämtern. Thomas PROROK weiß um die Probleme des öffentlichen Sektors in den Westbalkanstaaten. Der Verwaltungsexperte erklärt, an welchen Schrauben gedreht wird und warum Eigeninitiative und Transparenz dabei wichtig sind.
Zwei Drittel der BürgerInnen der Westbalkan-Länder* vertrauen ihren Regierungen und Parlamenten nicht. 71 % geben an, dass die Regierungen Korruption nicht effektiv bekämpfen. Diese Zahlen stammen aus dem neuesten Balkan Barometer, das jährlich die öffentliche Meinung in Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien zu wichtigen Fragen von Politik und Wirtschaft erhebt. Es sind Zahlen, die nachdenklich machen, vor allem, weil sie sich in den letzten Jahren nicht verbessert haben. Gleiches gilt für die Worldwide Governance Indicators: Hier misst die Weltbank in fast allen Ländern der Welt verschiedene Aspekte der Regierungsführung und Verwaltung. Auf einer Skala von -2.5 (geringe Effektivität) bis 2.5 (hohe Effektivität) rangieren die Länder des Westbalkans im Kriterium Government Effectiveness bei -0,62 bis 0,01. Hierzu zählen zum Beispiel die Qualität der öffentlichen Services und des öffentlichen Dienstes. Der Vergleichswert Österreichs liegt bei 1,49. Ein ähnliches Bild zeigt sich bei Fragen der Rechtsstaatlichkeit und politischer Mitbestimmung.
Abwanderung der Unzufriedenen
Die wohl dramatischste Konsequenz dieser Entwicklungen ist die Abwanderung, von der die gesamte Region betroffen ist. Die Weltbank sowie das Wiener Institut für internationale Wirtschaftsvergleiche haben zwischen 1989 und 2015 einen Bevölkerungsrückgang von 4,4 Millionen Menschen in der Region ausgemacht. Und das bei nur 18 Millionen BürgerInnen. Die Europäische Kommission hat die Problematik erkannt und 2020 eine EU-Erweiterungsstrategie für den Westbalkan inklusive Roadmap für das Funktionieren der demokratischen Institutionen und eine Verwaltungsreform präsentiert. Diese macht den Zusammenhang von funktionierenden demokratischen Strukturen und einer »guten« öffentlichen Verwaltung sichtbar: Good Governance ist ein wichtiges Fundament für die demokratische Prosperität eines Staates. Das KDZ-Zentrum für Verwaltungsforschung engagiert sich am Westbalkan gemeinsam mit seinen Partnern mit drei wichtigen Initiativen, die in der Folge kurz vorgestellt werden.
Zivilgesellschaft als Korrektiv
Das Projekt WeBER ist ein Zusammenschluss von zivilgesellschaftlichen Organisationen des Westbalkans, welche die Fortschritte der Verwaltungsreformen in der Region überprüfen. Dabei legt das von der EU unterstützte Projekt besonderen Wert auf die Sichtweisen von BürgerInnen und der Zivilgesellschaft. Es verwundert nicht, dass insbesondere Transparenz, Partizipation und Offenheit der Verwaltung eingefordert werden. Die Ergebnisse sind zum Teil ernüchternd: So finden nur 13 % der befragten zivilgesellschaftlichen Organisationen in der Region, dass die Entscheidungsfindung ihrer Regierung im Allgemeinen nachvollziehbar ist. Ein spezifischer Fokus liegt auf der Haushaltstransparenz, die sehr unterschiedlich ausgeprägt ist. In allen Ländern gibt es zwar Bestrebungen, die Transparenz der öffentlichen Budgets zu verbessern – in Nordmazedonien und im Kosovo wurden hierfür sogar bürgerfreundliche Haushaltsportale ausgebaut – aber nur in Nordmazedonien wird das Jahresbudget auch im Open-Data-Format veröffentlicht. Nichtfinanzielle Leistungsinformationen finden sich lediglich in dem Haushalt Albaniens und Ansätze von Bürgerbudgets gibt es nur in Montenegro. Als besonders problematisch stellt WebER fest, dass die Angaben von Montenegro und Serbien 2017 und 2018 weniger transparent waren als zuvor und auch nur wenige funktionale Informationen (z.B. Mittel für Soziales, Bildung, Gesundheit) bereitstellten.
Sichtbarmachen von Fortschritten
Mit dem Städteverband Südosteuropas wurde eine Onlineplattform aufgebaut, die erstmals für alle Länder des Westbalkans zeitnahe, genaue, zuverlässige und vergleichbare Indikatoren und Informationen zur lokalen Governance zugänglich macht. Die benutzerfreundliche Visualisierung komplexer Daten erlaubt es, die Fortschritte in der Dezentralisierung und der lokalen Selbstverwaltung zu überprüfen. Darüber hinaus ist sichtbar, welche Budgets für die Städte und Gemeinden zur Verfügung stehen, um wichtige öffentliche Leistungen wie Bildung, Kindergarten, soziale Hilfen und Infrastruktur für die BürgerInnen zu erbringen. Diese Transparenz-Plattform zeigt eindringlich, dass die kommunale Budgetautonomie abnimmt. Im Durchschnitt gingen die Einnahmen der Gemeinden in Südosteuropa zwischen 2015 und 2017 um 0,5 % zurück. Der Anteil, über den die Gemeinden autonom entscheiden können, verringert sich, während der Anteil von zweckgebundenen Zuschüssen ansteigt. Zentrales Problem ist das Generieren eigener Einnahmen, welches durch häufige Änderung der Rechtsrahmen sowie veraltete Register erschwert wird. Dadurch verliert die Regional- und Gemeindeautonomie als wichtiger Ausgleichsmechanismus im staatlichen Machtgefüge sukzessive an Bedeutung.
Transparenz und Partizipation bewerten
Vor nunmehr 20 Jahren haben sich die MinisterInnen für öffentliche Verwaltung der EUMitgliedsländer auf ein gemeinsames Instrument zur Qualitätsverbesserung ihrer Services geeinigt. Seither firmiert unter der etwas sperrigen Bezeichnung CAF (Common Assessment Framework – deutsch: Gemeinsamer Bewertungsrahmen) ein mächtiges, aber in der Öffentlichkeit wenig bekanntes, Werkzeug zur Verwaltungsreform. Bei diesem europäischen Ansatz geht es darum, dass öffentliche Verwaltungen, also Ministerien, Länder, Gemeinden, Sozialversicherungen sowie Verbände oder öffentliche Unternehmungen, selbstständig und andauernd einen Verbesserungsprozess initiieren. Das heißt, diese warten nicht auf den nächsten Aufruf zur Verwaltungsreform, sondern werden selber aktiv: Sie hinterfragen regelmäßig die internen Abläufe und digitalisieren schrittweise ihre Behörden, sie fördern die Personalentwicklung auf höchstem Niveau, sie leben Partizipation, Transparenz und arbeiten kundenorientiert. Das alles erfordert eine neue Kultur der Offenheit in der öffentlichen Verwaltung und Politik der Länder des Westbalkans. Dass der CAF ein wirksames Instrument zur Verwaltungsreform ist, zeigt auch die Europäische Kommission: Bei den Beitrittsverhandlungen überprüft die Kommission die Umsetzung der rechtsstaatlichen Grundlagen, zu denen auch die Maßnahmen zur Verwaltungsreform zählen. Dabei stellt die Kommission (genauer die SIGMA Initiative von OECD und EU) auch dezidiert die Frage, ob der Bewertungsrahmen eingesetzt wird. Mit der Regional School for Public Administration (ReSPA) hat das KDZ-Zentrum für Verwaltungsforschung deshalb ein umfassendes CAF-Programm initiiert. Dieses führte den Bewertungsrahmen als neues Instrument der Verwaltungsreform in Albanien, Bosnien-Herzegowina, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien ein. Gemeinsam mit den zuständigen Ministerien dieser Länder wurden mit Unterstützung der Austrian Development Cooperation in den letzten Jahren insgesamt 19 CAF-Initiativen umgesetzt.
Demokratiemotor Good Governance
Diese drei konkreten Initiativen zeigen, dass Reformen der öffentlichen Verwaltung in Richtung Good Governance zur Stärkung der demokratischen Strukturen beitragen können. Besonderes Potenzial haben neben der Festigung der Rechtsstaatlichkeit und Servicequalität hierbei der Ausbau von Transparenz und die Einbindung von BürgerInnen sowie der Zivilgesellschaft. Dies ist notwendig, um Vertrauen und Legitimität in Verwaltung, Staat und Demokratie zu stärken. Klar ist aber auch: Die öffentliche Verwaltung kann hier nur einen wichtigen Beitrag leisten. Demokratie muss jeden Tag neu erkämpft werden und hierfür bedarf es der ehrlichen Unterstützung durch die politischen AkteurInnen.
*Zu den Westbalkan-Ländern (WB6)
zählen jene Staaten Südosteuropas, die noch nicht Mitglied der Europäischen Union sind: Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien.
Thomas Prorok ist stellvertretender Geschäftsführer des KDZ-Zentrum für Verwaltungsforschung. Seine Expertise umfasst seit 20 Jahren die Themen Verwaltungsreform, Dezentralisierung, lokale Selbstverwaltung und EU-Integration. Er ist Mitglied des Vorstandes des IDM und des Beirates der Regional School for Public Adminstration des Westbalkans (ReSPA). Seit 2015 leitet er das BACIDProgramm zum Aufbau von Verwaltungskapazitäten im Westbalkan und der Republik Moldau.