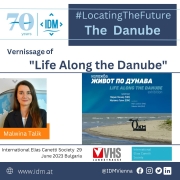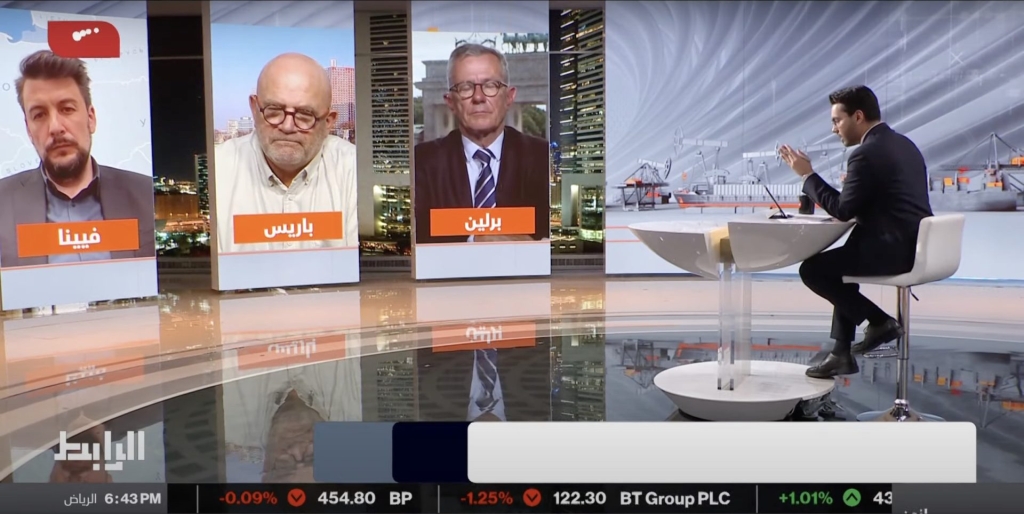Das stille Opfer des Ukraine-Krieges

Bewaffnete Konflikte wirken sich nicht nur auf Menschen, sondern auch auf gesamte Ökosysteme aus. Am Beispiel ihrer ukrainischen Heimatstadt Mykolajiw erklärt die Süßwasserökologin OLEKSANDRA SHUMILOVA die weitreichenden Folgen des Ukraine-Krieges für Mensch, Tier und Umwelt.
Der Text wurde in der Ausgabe 2/2023 von Info Europa veröffentlicht. Die vollständige Ausgabe ist hier zu lesen.
Seit Februar 2022 richtet sich die Aufmerksamkeit der ganzen Welt auf den Krieg in der Ukraine. Er beeinträchtigt das Leben von Millionen von Menschen und hat vielfältige Konsequenzen, die weit über die ukrainischen Grenzen hinausreichen. Die Natur ist das stille Opfer dieses verheerenden Krieges. Militäraktionen führen zu massiven Bränden, zur Verschmutzung von Böden und Luft und haben drastische Folgen für die Tierwelt. Die Auswirkungen des Krieges auf das Wasser – und des Wassers auf den Krieg – waren jedoch eine der ersten, die viele Ukrainer*innen zu spüren bekamen.
Verzweigte Schäden
Obwohl schon lange zu Folgen von Militäraktionen auf Wassersysteme geforscht wird, ist der Fall der Ukraine besonders. Im Gegensatz zu den Konflikten im hauptsächlich landwirtschaftlich geprägten Globalen Süden ist die Wasserinfrastruktur der Ukraine hoch industrialisiert. Sie umfasst große Stauseen, Wasserkraftwerke, Kühlbecken für Kernkraftwerke, Wasserreservoirs für Industrie und Bergbau sowie ein ausgedehntes Netz an Wasserverteilungskanälen für landwirtschaftliche und kommunale Zwecke. Wie verheerend die Schäden durch Kriegsinterventionen sind, zeigte der Bruch des Kachowkaer Staudamms. Anfang Juni 2023 wurde dieser gesprengt – erste Hinweise deuten auf russisches Kalkül (Stand: Juni 2023). Ganze Landstriche wurden geflutet, Äcker, Industrieanlagen und Siedlungen zerstört. Zudem herrscht Sorge um das größte europäische Kernkraftwerk Saporischschja, das mit Kühlungswasser aus dem Stausee versorgt wurde. Das ganze Ausmaß und die langfristigen Folgen der Schäden werden enorm sein und sind immer noch schwer absehbar.
Als Süßwasserökologin, die in der Ukraine aufwuchs, brachte mich die Bedrohung der Wasserinfrastruktur, der Wasserressourcen und der Ökosysteme durch den Krieg schon seit Beginn der russischen Invasion zum Nachdenken. Ich wollte meinem Land mit meiner Expertise helfen. Der Ausbruch des Krieges fiel mit einer Übergangsphase in meinem Leben zusammen und es kostete viel Mühe, meine eigene Forschungsgruppe aufzubauen. Dennoch schaffte es mein Team, die Auswirkungen auf die Wasserressourcen und -infrastruktur während der ersten drei Monate des Krieges zu analysieren. Die Ergebnisse zeigen, wie vielfältig die Folgen militärischer Aktionen waren. Der Betrieb von Wasseraufbereitungsanlagen wurde mehrfach unterbrochen, Wasserleitungen und Kanäle beschädigt, Dämme brachen schon damals und verursachten Überflutungen. Hinzu kam die Gefahr von nautischen Minen. Im Süden der Ukraine bedrohten Militäraktionen das Netz der Bewässerungskanäle, während Angriffe im Osten das Abpumpen von Wasser aus unterirdischen Minen verhinderten, was zu einem unkontrollierten Anstieg von verschmutztem Minenwasser führte. Das wirkte sich wiederum auf Grund- und Oberflächenwasser aus. Obwohl die Regionen, in denen intensive Bodenkämpfe stattfanden, am stärksten betroffen waren, wurden Auswirkungen auf das Wasser auch weit entfernt von den aktiven Kampfgebieten festgestellt. Besonders dramatisch ist der Anstieg der Zahl der Menschen in der Ukraine, die Wasser-, Sanitär- und Hygienehilfe benötigen: Zwischen April und November 2022 stieg sie von sechs auf 16 Millionen.
Das salzige Wasser von Mykolajiw
Vom Bruch des Kachowkaer Staudamms ist auch die Region rund um meine Heimatstadt Mykolajiw betroffen. Mit Wasserproblemen hat die Stadt aber schon seit Beginn der russischen Invasion zu kämpfen. Bereits im April 2022 wurde eine 90km lange Pipeline, die Wasser aus dem Fluss Dnipro lieferte, durch Kampfhandlungen zerstört. Eine halbe Million Einwohner*innen hatte plötzlich kein Leitungswasser mehr. Überall sah man Menschen mit Trinkwasserkanistern, die sie von Lieferfahrzeugen bekamen. Obwohl Mykolajiw von zwei Flüssen umgeben ist, eignet sich ihr Wasser aufgrund der hohen Salzkonzentration nicht zum Trinken. Nach einem Monat wurde beschlossen, das Flusswasser trotz geringer Qualität in die Wasserleitungen zu lenken, damit die Menschen es wenigstens für Haushaltszwecke wie Putzen oder Wäschewaschen nutzen können. Es war eine schwierige Entscheidung, da salziges Wasser Rohrleitungen korrodieren lässt. Nach über einem Jahr ist das Leitungswasser noch immer rostig und die Zahl der beschädigten Rohrleitungen in Mykolajiw steigt an. Die Frontlinie verschob sich mittlerweile in den Osten der Stadt und die Orte, an denen die Wasserversorgungsleitung zerstört wurde, sind dadurch zugänglicher. Aufgrund der Gefahr wiederholter Angriffe und der insgesamt vielen Schäden stehen die Reparaturen dennoch weiter aus.
Die unzureichende Wasserversorgung ist einer der Hauptgründe, warum sich viele Flüchtlinge aus Mykolajiw nach wie vor weigern zurückzukehren. Die in der Stadt verbliebenen, zumeist alten Menschen verbringen ihren Alltag mit der ständigen Suche nach Wasser. Regierungsangestellte und Freiwillige halfen bei der Errichtung mehrerer Brunnen, die ihnen Zugang zu Trinkwasser verschaffen. Bis Mitte Februar 2023 wurden 189 Brunnen errichtet und es ist geplant, diese Zahl auf bis zu 250 zu erhöhen – trotz der hohen Kosten von rund 25.000 Euro pro Brunnen. Auch wenn diese Maßnahmen der Bevölkerung helfen, stellen sie eine neue Umweltbedrohung dar, da der Grundwasserspiegel durch die umfangreiche Entwässerung des Bodens sinkt.
Im April 2023 genehmigte die Europäische Investitionsbank die Bereitstellung zusätzlicher finanzieller Mittel in Höhe von 20 Millionen Euro für den Ausbau der Wasserversorgung und des Abwassersystems in Mykolajiw. Das örtliche Wasserversorgungsunternehmen erwägt den Bau einer neuen Pipeline, die Wasser aus dem Südlichen Bug flussaufwärts transportiert, oder die Einrichtung groß angelegter Umkehr-Osmosesysteme, die dazu beitragen, das aus der Dnipro-Bug-Mündung entnommene Salzwasser zu reinigen.
Wasser hat höchste Priorität
Der Zugang zu Wasser ist ein grundlegendes menschliches Bedürfnis, das durch zahlreiche internationale Übereinkommen geschützt ist. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen verabschiedete am 27. April 2021 eine Resolution, gemäß der alle an einem bewaffneten Konflikt beteiligten Parteien verpflichtet sind, die Zivilbevölkerung und die zivile Infrastruktur, einschließlich Wassereinrichtungen, zu schützen. Aber funktioniert das auch, wenn tatsächlich ein Krieg ausbricht? Viele Wassertechniker*innen wurden während Reparaturen beschädigter Infrastruktur getötet oder verletzt. Die oft schlechte Qualität des gelieferten Wassers hat negative Auswirkungen auf die Gesundheit und erhöht die Gefahr von Epidemien. Das zwingt Menschen dazu an andere, bessere Orte zu ziehen.
Flüsse kennen keine Grenzen. Die meisten Flüsse auf dem Gebiet der Ukraine münden in das Schwarze und das Asowsche Meer, was zu einer potenziellen Verbreitung von Schadstoffen und negativen Folgen für lebende Organismen führt. Es wird Jahre dauern, bis wir das ganze Ausmaß dieser Auswirkungen verstehen, aber einige von ihnen – wie die Gefahr für die globale Ernährungssicherheit – sind bereits jetzt spürbar. Daher sollten die Wiederherstellung der Wasserinfrastruktur und die Sanierung der Wasserressourcen ein integraler Bestandteil des friedensschaffenden Prozesses werden.
»Impact of the Russia–Ukraine armed conflict on water resources and water infrastructure«, Oleksandra Shumilova et al., in Nature Sustainability 6, 2023.
Oleksandra Shumilova arbeitet am Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei in Berlin. Sie forscht zu Wechselwirkungen zwischen Mensch und Natur sowie nachhaltiger Entwicklung. Ihre Forschung umfasst auch die Ökologie intermittierender Flüsse sowie die Hydro- und Morphodynamik von Flussauen.